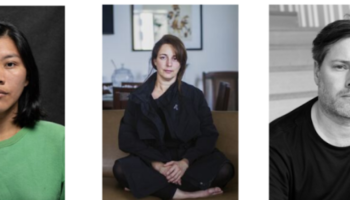Es ist schon zum Verzweifeln. Da erfanden die Menschen Städte, um sicher und selbstbestimmt zusammenzuleben und sich gegen Angriffe von außen zu verteidigen – und heute werden sie im Inneren dieser Städte übertölpelt, entmachtet und weggeschubst. Von neofeudalen Großprojekten, globalen Konzernen, Immobilienspekulantinnen und anderen Trojanern. Ach ja: und die echten Lokalpatrioten, die nationalistischen Straßenkehrer, die schubsen mit.
Die Stadt ist für ihre Bürger nicht mehr sicher. Nicht etwa, weil Flüchtlingsbanden nach Mitternacht durch die Gassen marodieren würden. Sondern weil die Wirtschaft für ihren Gewinn soziale Mähdrescher auf die Straße schickt, die Ressource Stadt zu plündern und nach ihrem Bilde umzubauen. Eigentlich soll ja das Parlament – die Politik – die Bürgerinnen der Stadt vor den Schurkinnen beschützen. In vielen Bereichen tut sie das auch. Aber in einem wichtigen Punkt tut sie es nicht: Wer wo und wie in der Stadt lebt und wer sie auch symbolisch beherrscht, das ist zur Frage eines deregulierten Überlebenskampfes geworden, den Politik und Bürgerschaft allmählich verlieren und den das Kapital gewinnt.
Ist das zu polemisch dargestellt? Sicher ist es mit grobem Pinsel gemalt und arg verkürzt. Die Realität ist komplexer. Aber schaut man auf die Kunst der letzten Jahre und Jahrzehnte, dann zeigt sich, dass die polemische Zuspitzung der Thematik oft den Kern der Sache traf, Position bezog, Meinungskapital freisetzte. Mal gelang ihr eine pointierte Kritik der sich wandelnden Verhältnisse – bis hin zur aktiven Denunziation verantwortlicher Akteure. Mal balgte sie sich schalkhaft mit dem Lauf der Geschichte. Mal träumte sie vom anderen, von der Stadt, die den Leuten gehört, die in ihr leben. Und solidarisierte sich dabei mit urbanen sozialen Bewegungen.

Insofern ist die Kunst ein schöner Gradmesser für das, was aus der Stadt geworden ist und (vielleicht) noch wird. Die Ausstellung zeigt einige Ansätze – von denen manche fast schon historisch geworden sind, andere flirren noch frisch in der Gegenwart – die zweifelnd auf die Entwicklung des städtischen Geschehens blicken, die Einspruch und Widerspruch erheben. So schlawinerisch sich das neoliberale Wirtschaftsphantasma allmählich in die soziale DNA der Stadtgesellschaft eingeschleust hat, um deren Bauplan zu verändern, so reagieren auch die Künstlerinnen und Künstler oftmals mit den Mitteln des Schlawinertums, um der durchrationalisierten Schurkerei zu begegnen und ihrerseits ein Stück Diskurshoheit zu reklamieren.
Stadtschlawinerinnen, das sind sie alle: Die, die sich mit ihren Investitionen und Deals reinfuchsen in historisch gewachsene und nun, oder bald, verschwundene, überbaute und transformierte Strukturen. Und die, die dazwischenfunken und – der schlussendlichen politischen Einflusslosigkeit der Kunst gewiss – uns zeigen, wie wir verstehen können, und ändern könnten, was mit der Stadt und uns geschieht.
Künstler: Arno Brandlhuber, Alice Creischer, Larissa Fassler, Adelita Husni-Bey, Peng!, Andrea Pichl, Dierk Schmidt, Andreas Siekmann, Michael E. Smith, Bárbara Wagner & Benjamin de Burca, Weekend & Plaste, et al
Text: Alexander Koch
KOW BERLIN, Lindenstrasse 35 · 10969 Berlin
Ausstellungsdauer: 7. September bis 9. November
Eröffnung: Freitag, 6. September 18.00 – 20.00 Uhr